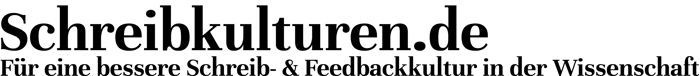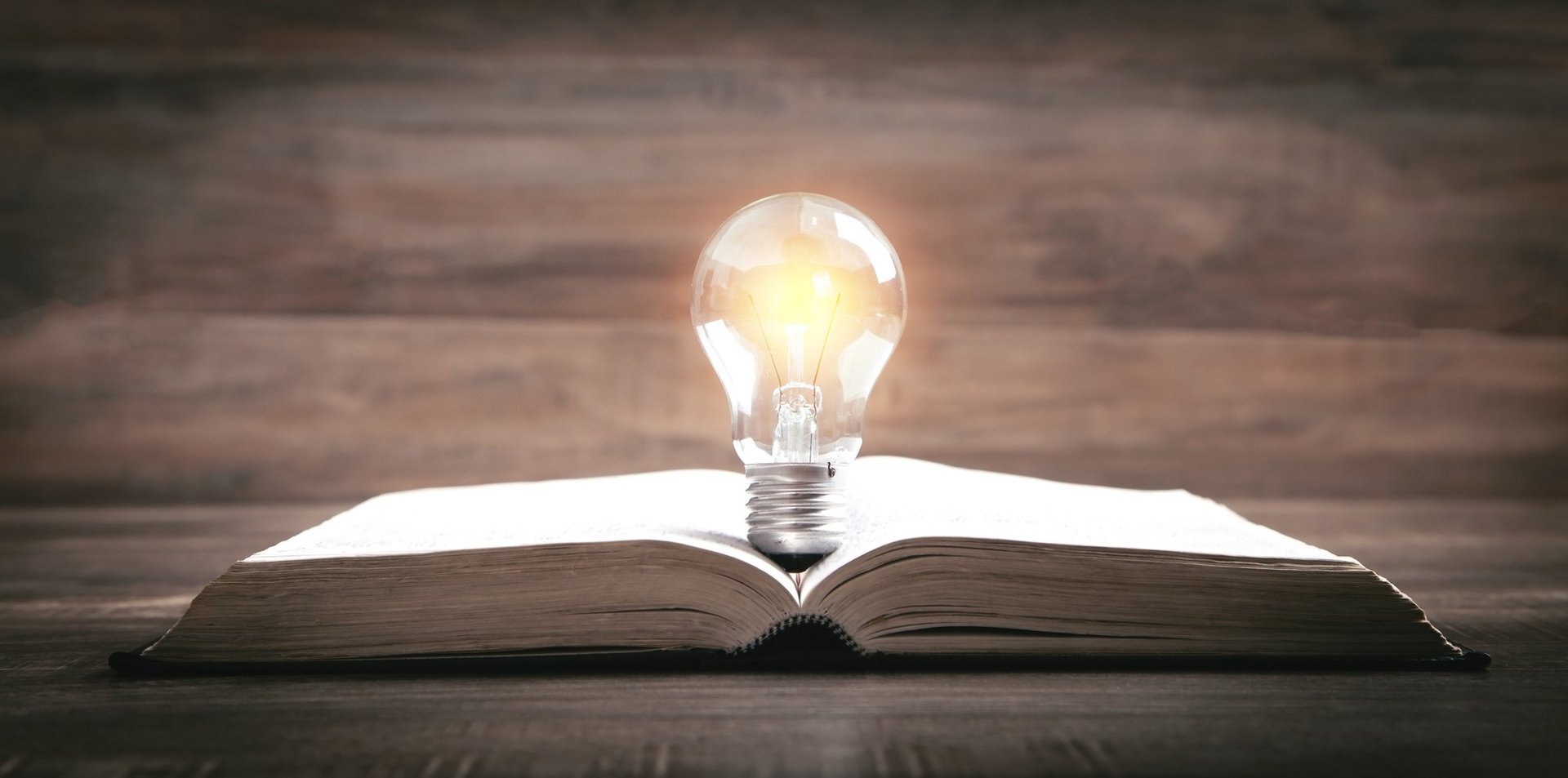
Was macht gute Texte aus?
Paradigmenwechsel in der Wissenschaft: Von überkomplexer zu verständlicher Wissenschaftssprache
3/7/20242 min read
"Die Begriffe, unter die ein Gegenstand fällt, sind Eigenschaften (des Gegenstandes). Gleichzeitig sind diese Eigenschaften Merkmale, aber nicht des Gegenstandes, sondern eines komplexeren Begriffes."
Ein sprachliches Relikt aus früheren Zeiten
So und ähnlich klingen viele Texte in meinem Fach. Philosoph:innen im Besonderen und Wissenschaftler:innen im Allgemeinen neigen zu überkomplexer Wissenschaftssprache. Daran, wie jemand schreibt, wird sichtbar, mit welchem Ideal von Wissenschaftssprache er:sie akademisch groß geworden ist: Die Wissenschaftssprache der alten Generation ist – nicht nur, aber auch – ein Werkzeug der Abgrenzung: Nur Eingeweihten ist es möglich, den Gedankengang des:der Autor:in nachzuvollziehen; und selbst das oft nur mit Mühe. Möglichst viel Inhalt in wenigen Worten unterzubringen galt jener Generation von Wissenschaftler:innen als Kunstform; das gelang mithilfe von Passivkonstruktionen, Nominalstil und einer hohen Dichte von Fachbegriffen.
Dabei ist fraglich, wie viel Inhalt tatsächlich in solchen Sätzen steckt. Vielfach sind lange Satzkonstruktionen ein Mittel um zu kaschieren, dass der:die Autor:in den Inhalt nicht wirklich durchdrungen hat. Oder mit (vermeintlich) Einstein gesprochen: You do not really understand something unless you can explain it to your grandmother. Tatsächlich ist es erstaunlich hilfreich, Studierende auf der Suche nach ihrer Forschungsfrage einen Brief an die eigene Großmutter schreiben zu lassen: Die Alltagssprache bietet eine Klarheit, die Wissenschaftssprache vermissen lässt.
Und heute?
Meiner Meinung nach ist das Maß aller Texte Verständlichkeit. Denn schließlich: Für wen schreiben wir, wenn wir nicht verstanden, nicht gelesen werden? Texte sind ein Mittel der Kommunikation. Kommunikation berücksichtigt den:die Adressat:in. Langsam setzt ein Paradigmenwechsel ein, der die Leser:innen von Texten in den Fokus rückt.
Also anders formuliert: Was macht Texte lesenswert?
Eine klare, pointierte Sprache ohne unnötigen Schnickschnack: Löschen Sie einmal alle Füllwörter und Adjektive; das gelingt meist ohne inhaltlichen Verlust.
Aktivische Sprache und ein Ich, wo immer ein Ich spricht. Es lohnt, den Deckmantel der Objektivität zu lüften: Dann kann eine authentische Schreibstimme (voice) entstehen. Dafür ist es nötig, sich von der Literatur zu lösen.
Und zugleich: Ein Dialog mit all jenen, die vor mir geschrieben haben, und auf die ich mich beziehe –der zum Ausdruck bringt, wann wer spricht, und die Stimmen im Gespräch miteinander verflechtet.
Eine wohldosierte Auswahl an narrativen Elementen und sprachlichen Bilder – denn das ist es, was Leser:innen im Gedächtnis bleibt.
Einen nachvollziehbare Argumentation, die den:die Leser:in zu jedem Zeitpunkt durch den Text führt. Verlieren Leser:innen mehrfach den Faden, verlieren Sie die Lust und steigen sprichwörtlich aus.
Eine optische Gestaltung, die dem:der Leser:in Luft zum Atmen gibt: Durch Absätze, Zwischenüberschriften und dezente Hervorhebungen. Dazu trägt auch bei: Eine Variation von langen und kurzen Sätzen, dichten und seichten Passagen.
Schreiben Sie mir!
via Kontaktformular oder an info@schreibkulturen.de